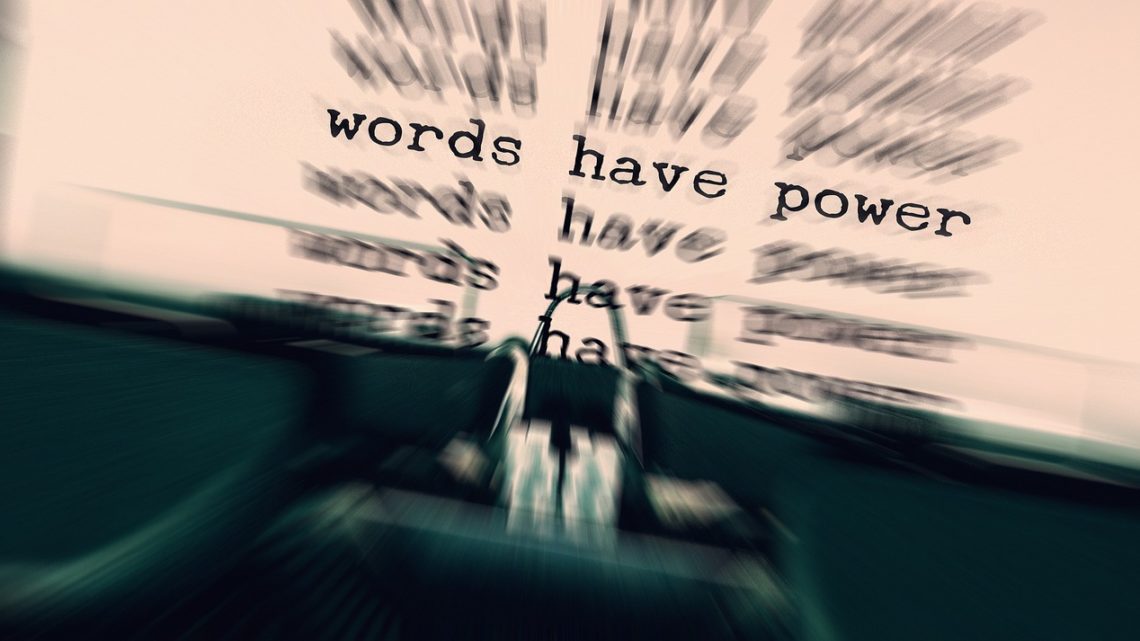Vom linken Sprechen mit der Klasse
Peter Porsch über die Sprache der LINKEN
Im Grunde ist es eine Binsenweisheit, dass die Partei DIE LINKE für jene da sein sollte, die sich am unteren Ende der sozialen Hierarchien und der Einkommensstufen befinden. Ich glaube nicht, dass es für die Anerkennung einer solchen Selbstverständlichkeit große Auseinandersetzungen in der Partei braucht. Dennoch sollten wir immer wieder kontrollieren, ob wir diesem Anspruch auch gerecht werden, programmatisch und praktisch in unserem politischen Handeln. Dazu braucht es Kommunikation, Kommunikation mit jenen Schichten der Bevölkerung, für die wir uns erfolgreich und bei den Betroffenen auch verständlich einsetzen wollen.
Freilich ist das gar nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Es genügt nicht unseren Anspruch zu formulieren und ihn ausführlich in geschliffener Sprache zu begründen. Wir müssen auch mit der Sprache derer umgehen können, die wir vertreten wollen. Das heißt nicht zu versuchen, so zu sprechen wie diese, sondern wir müssen lernen ihnen zuzuhören und zu verstehen, was sie sagen und vor allem wie sie es sagen.
Seit über 50 Jahren und wahrscheinlich auch schon länger ist dies in den Schriften zur Arbeiterbildung bekannt. Die hier gemeinten Menschen reden über ihre soziale Lage nicht in komplizierten, von detaillierter Analyse geprägten Texten, sondern – so nennt es Oskar Negt 1968 in seinem Buch „Soziologische Phantasie und exemplarisches Lernen. Zur Theorie der Arbeiterbildung“ – in einer Sprache „impliziter Bedeutungen“. Dabei fassen Menschen ihre sozialen Erfahrungen in einfachen Äußerungen zusammen, denen aber ihre gesamte Erfahrungswelt zugrunde liegt. Sprechen sie zum Beispiel über Arbeitslosigkeit, so zergliedern sie ihre Erfahrung nicht in Ursache, Auswirkung und Auswegmöglichkeiten, sondern allein mit diesem Wort wird alles ausgesprochen, schwingt ihre gesamte Betroffenheit von Arbeitslosigkeit als Erleben, Angst, Widerstand und Bewältigung mit, ohne dies im Einzelnen auszubreiten. Ihre erlebte Stellung in der Gesellschaft bündelt sich oft in Aussagen wie: „Nützt ja alles nichts“. „Du weißt schon“. „Und? Wer wird es wieder bezahlen?“. „Die sind doch alle gleich“. „Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen“. Und so weiter, und so weiter. Solche Sätze greifen auf die Annahme gemeinsamer Erfahrung genauso zurück wie auf die Annahme daraus resultierender Solidarität. Es ist zugleich resignativ und aggressiv, hilflos und kampfbereit. Es ist getragen von Klasseninstinkt, geboren in Klassenerfahrung, nicht aber schon von Klassenbewusstsein. So sprechen die Menschen nicht als analysierende Angehörige der Klasse, sondern als Betroffene der Klassengesellschaft. Fragt man nach, bekommt man deshalb höchst selten systematische Durchdringung der Lebenssituation und entsprechende Schlussfolgerungen. Es werden vielmehr Geschichten „aus dem Leben“ erzählt. Auf die kommt es aber an. Sie erzählen von der Klassenlage. In diesen Geschichten bekommen Menschen ihre Identität als Mitglieder einer Klasse. Die Klasse ist aber bereits eine höhere Abstraktion. Zuerst ist es das konkrete Leben, das prägt, das konkrete Leben von Beschäftigten an der Supermarktkasse, im Lager von Menschen mit Migrationsgeschichte, von Menschen jüdischen Glaubens und vielen anderen mehr.
Die AfD benutzt das geschickt. Sie erzählt die Geschichten undifferenziert weiter. Sie verwandelt dabei aggressive Hilflosigkeit in aggressive Frechheit. Freilich auch nicht mehr. Dabei erzielt diese Partei jedoch offensichtlich den Effekt, als Organisation wahrgenommen zu werden, die sich was traut. Dass sie deshalb noch nichts kann, ist nicht so wichtig. Am besten wirkt dieses analytische Vakuum verbunden mit pseudokämpferischem Anspruch, wenn man sich bis zu den Grenzen der Sprache des Faschismus vorwagt oder sie fallweise auch überschreitet. Das wirkt, ist freilich brandgefährlich und politischer Betrug an den Menschen, für die zu sprechen man vorgibt.
Einen anderen Betrug für das gleiche soziale Umfeld findet man bei der FDP: „Bei uns kann jeder alles werden, egal, wo er herkommt.“ Man könnte das ja als Vorgriff auf sozialistische Ideen der Chancengleichheit verstehen. Es ist aber etwas ganz anderes. Gerade bei jungen Leuten, die zum ersten Mal wählen, die noch Träume vom künftigen Leben haben, bedient es diese Träume. Wie im Groschenroman eröffnet es eine angeblich realisierbare Wunschwelt des eigenen Willens. Dennoch ist es nichts anderes als eine Reproduktion der negativen Seiten jener „impliziten Bedeutungen“, in denen die Lebenserfahrungen zusammengefasst sind. Der Ausweg ähnelt dem Traum vom Lottogewinn, den man erreichen kann, wenn man nur oft genug spielt.
Unsere linke Aufgabe ist eine entgegengesetzte. Wir sollten nicht schlau und selbstgerecht und selbstverliebt versuchen, wie die einfachen Arbeiter*innen zu sprechen. Uns muss es vielmehr gelingen, aus ihren Geschichten verständliche politische Programme und Projekte zu machen. Das braucht eben zuallererst genaues Zuhören. Unsere linke Aufgabe ist es, erst danach im neugierigen und geduldigen Gespräch, das sich in Teilhabe verwandelt, die Abstraktionsebene der Klasse so darzustellen, dass daraus auch das Gefühl der Betroffenheit entsteht, dass die Zugehörigkeit zur Klasse nicht vom eigenen Erleben getrennt wird, sondern vielmehr aus dem eigenen Erleben verständlich wird. So verhelfen wir wenig reflektierten Erlebniskomplexen zu einem politisch wirksamen Klassenbewusstsein.
Lernen wir das zu erlernen! Lernen wir Arbeiterbildung, nicht Arbeiterbelehrung!